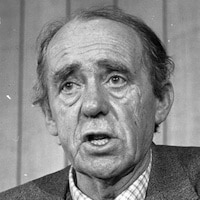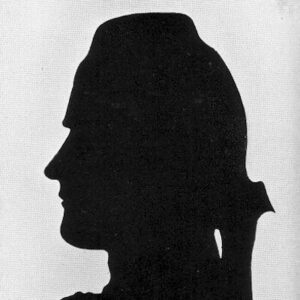Heinrich von Kleist wurde am 18. Oktober 1777 in Frankfurt an der Oder geboren und am 27. Oktober in der Garnisonskirche getauft. Kleist entstammte einem alten pommerschen Adels- und Offiziersgeschlecht und trat nach dem Besuch des französischen Gymnasiums in Berlin in das Potsdamer Garderegiment ein. Direkt nach der Konfirmation am 20. Juni 1792 – wieder in der Garnisonskirche zu Frankfurt – trat er seinen Dienst an, kam aber vorerst noch um einen Einsatz im Kampf herum, da sein Regiment Winterquartier bezog. Kleist erhielt Heimaturlaub.
Nachdem sein Vater bereits am 18. Juni 1788 gestorben war, starb am 3. Februar 1793, während seines Heimaturlaubs, auch seine Mutter. Mit 16 Jahren war Kleist Vollwaise. Im Anschluss an den Heimaturlaub ging es für ihn schließlich an die Front.
Seine militärische Karriere ließ sich dabei nicht schlecht an – ganz in der Familientradition. Die Familie von Kleist ist tatsächlich die preußische Familie, die die meisten Träger des Preußischen Verdienstordens Pour le Mérite aufzuweisen hat. Dennoch beendete Kleist die Militärkarriere bereits 1799 und nahm ein Studium auf.
An der Viadrina Universität in Frankfurt an der Oder hörte Kleist Vorlesungen in Physik, Naturrecht, Kulturgeschichte und Mathematik und nahm Privatstunden in Latein. Er arbeitet als Privatlehrer und verlobte sich heimlich mit Wilhelmine von Zenge, einer seiner Schülerinnen. Nach nur drei Semestern, in der Mitte des Jahres 1800, brach er das Studium ab und begab sich mit dem neun Jahre älteren Ludwig von Brockes, einem Enkel des berühmten Hamburger Dichters Barthold Heinrich Brockes, auf eine Reise, die zuerst Wien zum Ziel hatte, dann aber nach Würzburg ging.
Im März 1801 geriet Kleist in die sogenannte Kant-Krise. Mit seiner Halbschwester Ulrike reiste er zunächst nach Dresden und dann nach Paris. Unterwegs trafen sie unter anderen den berühmten Anthropologen Ernst Platner (Leipzig), den Dichter Johann Ludwig Gleim (Halberstadt) und den Galeriedirektor Johann Heinrich Tischbein (Kassel). In Paris bekamen sie Kontakt zu Wilhelm von Humboldt. Ende November fuhr Kleist, nach Frankfurt am Main zurückgekehrt, alleine weiter nach Bern, wo er sich mit Heinrich Zschokke, Ludwig Wieland (dem Sohn Christoph Martin Wielands) und Heinrich Geßner (Ludwig Wielands Schwager) anfreundete. In ihrer gemeinsamen Wohnung hing der Kupferstich, den sie zum Anlass eines Dichterstreits machten, und der als Vorlage für »Der zerbrochne Krug« diente.
Im Mai löste er offiziell die Verlobung mit Wilhelmine von Zenge.
Weitere Reisen schlossen sich an. In Aussicht gestellte berufliche Hoffnungen erfüllten sich nicht, und auch auf dem Gebiet der Literatur war Kleist nicht sehr erfolgreich.
1807 wurde Kleist von der französischen Besatzungsmacht in Berlin unter Spionageverdacht verhaftet und für ein halbes Jahr inhaftiert. 1808 gründete er, wieder in Freiheit, das Magazin »Phöbus«, in dessen zweiter Ausgabe seine berühmte Novelle »Die Marquise von O…« erschien.
Es folgten unstete Jahre, in denen er sich in Paris und der Schweiz, in Königsberg, Dresden und zuletzt in Berlin aufhielt. Sein Dasein war geprägt von existentieller Unruhe und ständiger Glückssuche, die zum Scheitern verurteilt war.
Im Herbst 1811 lernte Kleist die an Krebs erkrankte Henriette Vogel kennen. Zwischen der verheirateten Berlinerin und dem Dichter entwickelte sich eine enge Beziehung, die ihren traurigen Abschluss am 21. November desselben Jahres fand. Am Kleinen Wannsee vor den Toren der Stadt erschoss Kleist zunächst Henriette und dann sich selbst. In seinem Abschiedsbrief an seine Halbschwester Ulrike heißt es: »Die Wahrheit ist, daß mir auf Erden nicht zu helfen war«.
Das Werk Heinrich von Kleists erscheint angesichts seines Umfangs und seiner Bedeutung wie losgelöst von dieser persönlichen Problematik. Seine Novellen (»Die Marquise von O…«, 1808, »Michael Kohlhaas«, 1810), Erzählungen (»Das Käthchen von Heilbronn«, 1808, »Das Bettelweib von Locarno«, 1810) und Dramen (»Penthesilea«, 1807, »Amphitryon«, 1807) reflektieren gesellschaftliche und menschliche Fragen in scheinbar objektiver Weitsicht und ohne die subjektive Tragik von Kleists Leben erkennen zu lassen.
Bis heute gehören Theaterstücke wie das Lustspiel »Der zerbrochene Krug« (1808) zu den meist inszenierten Werken auf deutschen Bühnen.