Parabel
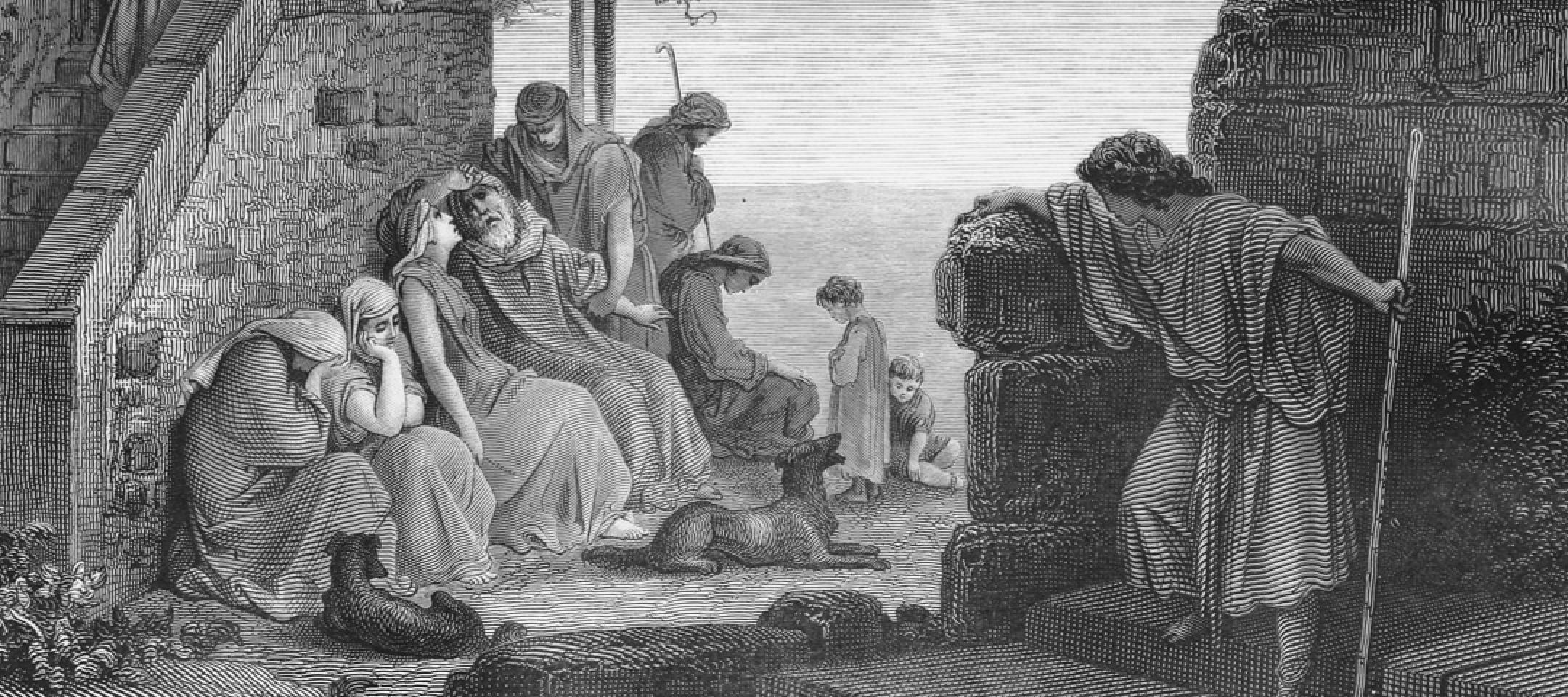
Eine Parabel ist eine kurze Erzählung, die eine Lehre vermitteln will. Der Leser soll eine allgemeine Wahrheit erkennen. Diese kann moralischer oder ethischer Natur sein und lässt sich auf sein eigenes Leben beziehen.
Übersicht:
Was ist eine Parabel?
Eine Parabel ist eine epische Kurzform, die mit dem Gleichnis verwandt ist. Der Begriff »Parabel« leitet sich ab vom griechischen parabole = Nebeneinanderwerfen, Vergleichung. Eine Parabel soll eine allgemeine Wahrheit veranschaulichen und für das eigene Leben nutzbar machen.
Merkmale einer Parabel
- Parabeln sind kurz und zweckgerichtet.
- Parabeln haben lehrhafte Züge.
- Parabeln schildern eine besondere Situation, um eine Allgemeingültigkeit zu veranschaulichen.
- Parabeln enthalten eine Bildebene, die auf eine Sach- oder Gedankenebene übertragen werden muss.
- Parabeln haben ein offenes Ende.
- Die Lehre einer Parabel muss der Leser selbst herausfinden.
- Parabeln sind antithetisch aufgebaut.
Kurz und zweckgerichtet
Ihren Ursprung hat die Parabel in der Rhetorik. Sie war in eine Rede eingebunden, nicht mehr als ein Einschub. Von daher ist eine Parabel kurz. Sie verfolgt einen Zweck, nämlich eine Lehre zu erteilen. Folglich verzichtet eine Parabel auf Ausschmückungen und alles, was nicht unbedingt notwendig ist.
Lehrhafte Züge
Eine Parabel will eine Lehre erteilen. Sie will eine allgemeine sittlich-moralische Wahrheit vermitteln. Diese Erkenntnis soll dem Leser einen Nutzen für seine eigene Wirklichkeit bringen.
Funktionsweise einer Parabel
Um etwas zu veranschaulichen nutzt die Parabel ein Bild aus einem anderen Vorstellungsbereich (analoger Vergleich). Um dieses Bild herum entsteht dann eine kurze Erzählung. Die Erzählung schildert eine besondere Begebenheit. Hinter dieser einzelnen Begebenheit verbirgt sich eine allgemeingültige Aussage.
Es ist Aufgabe des Lesers, das vergleichende Bild des parabolischen Textes auf die Gedankenebene zu übertragen. Wissenschaftlich ausgedrückt: Er muss das Tertium Comparationis finden, die Gemeinsamkeit, das, in dem das Bild der Parabel mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Anschließend kann er Analogieschlüsse auf sein eigenes Leben ziehen.
Offenes Ende
Die Parabel löst die Situation am Ende nicht auf. Es gibt kein »happy end«, mit dem sich der Leser zufrieden geben kann. Im Gegenteil: Da eine Lösung fehlt, bleibt der Leser mit der eigentlichen Geschichte allein. Er wird von sich aus weiter darüber nachdenken und zu einer Erkenntnis gelangen. Damit hat die Parabel ihr Ziel erreicht.
Einer Parabel reicht unter Umständen ein vergleichendes Bild. Das lässt sich an der bekannten »Ringparabel« aus Lessings Drama »Nathan der Weise« verdeutlichen: Die drei Ringe (Bildebene) stehen für die drei monotheistischen Weltreligionen Judentum, Islam und Christentum (Sachebene). Durch die Schilderung vom Tod des Vaters und der Erbstreitigkeiten wird das Bild zu einer Erzählung erweitert.
Ihre Wurzeln hat die Parabel in der antiken Rhetorik. Sie war dort in eine Rede eingebettet und sollte die Argumentation verdeutlichen und unterstützen. Das erklärt auch die Merkmale der Kürze und Zweckmäßigkeit. Bekanntestes Beispiel ist die »Parabel vom Magen und den Gliedern«. Damit fand Menenius Agrippa um 500 v. Chr. ein Bild für das Verhältnis von Senatoren und Bürgern.
Parabel als Binnenerzählung
In der Rhetorik war die Parabel ein Einschub, um Argumente zu stützen und zu veranschaulichen. Mitunter wird sie deshalb nicht als eigenständige literarische Form betrachtet. Sie ist dann eher eine illustrierende und erklärende Beifügung. Dies gilt vor allem für Parabeln als Binnenerzählung. Man findet sie eingebunden in größere Texte. Das kann ein Drama oder ein Roman sein. Ein bekanntes Beispiel ist die »Ringparabel« aus Lessings Drama »Nathan der Weise«. Auch die Erzählung »Die Worteschüttlerin« in Martin Zusaks Roman »Die Bücherdiebin« gilt als Parabel.
Beispiele für Parabeln
- »Parabel vom Magen und den Gliedern« (Menenius Agrippa)
- »Parabel von der Heimkehr des verlorenen Sohnes« (Neues Testament Lk 15,11-32)
- »Der Glieder Streit mit dem Magen« (Friedrich von Hagedorn, 1738)
- »Jüdische Parabeln« (Gottfried Herder, 1802)
- »Geschichten vom Herrn Keuner« (Bertolt Brecht, 1926–1956)
- »Das Eisenbahngleichnis« (Erich Kästner, 1931)
- »Zentralbahnhof« (Günter Kunert, 1972)
Auch manche der Werke Franz Kafkas werden als Parabeln bezeichnet. Ihre Besonderheit liegt darin, dass sie sich auf vielerlei Weise – oder auch gar nicht – entschlüsseln lassen. Sie bleiben für den Leser rätselhaft und unergründlich.
Unterschiede zwischen Parabel und Fabel
Ebenso wie die Parabel zählt auch die Fabel zu den lehrhaften Erzählungen. Doch gibt es drei wesentliche Unterschiede zwischen den Textsorten.
- In einer Fabel handeln Tiere, die mit menschlichen Eigenschaften ausgestattet sind; dagegen sind die Handelnden in einer Parabel Menschen.
- In einer Fabel wird die moralische Lehre explizit formuliert und als Lehrsatz angefügt; dagegen muss die Lehre in einer Parabel vom Leser erarbeitet werden: Übertragung der Bildebene auf Gedankenebene und Interpretation.
- Bei einer Fabel ist die ganze Geschichte übertragbar. Bei einer Parabel gibt es meist nur ein vergleichendes Bild, das entschlüsselt werden muss.
Das Drama als Parabel: Parabelstücke
Parabelstücke sind Dramen, die im Ganzen als Parabel konzipiert sind. Geprägt wurde der Begriff von Bertolt Brecht. So bezeichnet er eine Reihe seiner eigenen Stücke, zum Beispiel »Der gute Mensch von Sezuan«. Das Stück konstruiert ein Modell, das menschlich-soziale Verhaltensweisen vereinfacht und verallgemeinert. Der Ort Sezuan steht darin stellvertretend für alle Orte in der Welt, wo Menschen von Menschen ausgebeutet werden. Es geht um die Fragen, inwieweit der Mensch überhaupt gut zu handeln vermag, und ob das unter den Bedingungen des Kapitalismus möglich ist.
- »Mann ist Mann« (Bertolt Brecht, 1926)
- »Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui« (Bertolt Brecht, 1957/1958)
- »Der gute Mensch von Sezuan« (Bertolt Brecht, 1943)
- »Turandot oder Der Kongreß der Weißwäscher« (Bertolt Brecht, 1954/1969)
- »Der Besuch der alten Dame« (Friedrich Dürrenmatt, 1956)
- »Biedermann und die Brandstifter« (Max Frisch, 1958)
- »Andorra« (Max Frisch, 1961)
Die Ausdehnung des Begriffs Parabelstück auf Werke moderner Dramatiker wie Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt oder Peter Hacks ist in der Literaturwissenschaft umstritten. Sie hätten – anders als die Stücke Brechts – nicht ausschließlich lehrhaften Charakter.
Dieter Lorenz (Herausgeber), bsv Grundwissen Deutsch: Nachschlagewerk für den Sekundarbereich I, Bayerischer Schulbuch Verlag, München, 1999.
Gero von Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 2013.